
 Seit zwei Tagen bläst der tausend Kilometer entfernte Golf schwülwarme Luft in die Stadt,
die plötzlich sehr anders aussieht. Überall stehen Tische auf den Straßen, sitzen
leichtbekleidete Menschen. Vor dem Hart House, an einem der Tische, sitzt ein älterer Herr,
aber er sitzt eigentlich nicht am Tisch, er hat sich vom Tisch weggedreht, am Nachbartisch
sitzt er eigentlich, und sucht ein Gespräch mit dem älteren Paar dort. Zwar ist Frühling,
aber er blitzt ab. Suchend schweift sein Blick, wir unterhalten uns grade über die Spatzen,
die unter den Stühlen hüpfen, aus dem Augenwinkel sehe ich ihn aufstehen, er steht an
unserem Tisch, "These are the Hart House
sparrows." Man füttere sie, das bringe Glück,
nun ja, mehr den Spatzen als denen, die füttern. Er lacht über seinen Witz, geht zurück
und setzt sich wieder.
Nach einer kurzen Pause zeigt er auf die Laternen entlang der Zufahrtsstraße: dort wohnen
sie, sagt er, und wirklich, aus den Eisenstreben unter jeder der Laternen quellen Bündel
von Stroh. Spatzennester, in Griffnähe und doch unsichtbar.
"Are you a student", fragt die Frau vom Nebentisch ihn, er lächelt, nein, ein Dozent für
alte Literatur sei er gewesen, aber das sei lange her.
Als er geht, spürt man einen Hauch Melancholie. Oder einen warmen Windstoß vom Golf.
Seit zwei Tagen bläst der tausend Kilometer entfernte Golf schwülwarme Luft in die Stadt,
die plötzlich sehr anders aussieht. Überall stehen Tische auf den Straßen, sitzen
leichtbekleidete Menschen. Vor dem Hart House, an einem der Tische, sitzt ein älterer Herr,
aber er sitzt eigentlich nicht am Tisch, er hat sich vom Tisch weggedreht, am Nachbartisch
sitzt er eigentlich, und sucht ein Gespräch mit dem älteren Paar dort. Zwar ist Frühling,
aber er blitzt ab. Suchend schweift sein Blick, wir unterhalten uns grade über die Spatzen,
die unter den Stühlen hüpfen, aus dem Augenwinkel sehe ich ihn aufstehen, er steht an
unserem Tisch, "These are the Hart House
sparrows." Man füttere sie, das bringe Glück,
nun ja, mehr den Spatzen als denen, die füttern. Er lacht über seinen Witz, geht zurück
und setzt sich wieder.
Nach einer kurzen Pause zeigt er auf die Laternen entlang der Zufahrtsstraße: dort wohnen
sie, sagt er, und wirklich, aus den Eisenstreben unter jeder der Laternen quellen Bündel
von Stroh. Spatzennester, in Griffnähe und doch unsichtbar.
"Are you a student", fragt die Frau vom Nebentisch ihn, er lächelt, nein, ein Dozent für
alte Literatur sei er gewesen, aber das sei lange her.
Als er geht, spürt man einen Hauch Melancholie. Oder einen warmen Windstoß vom Golf.
 Aus der grade noch klaren Luft fallen übergangslos kleine Schneeflocken und legen sich auf
die Windschutzscheiben der Autos. Die Straße ist belegt mit einer großen, unbeweglichen
Autowurst, leicht zu überqueren heute, am ersten Tag des Nahverkehrsstreiks. Auf der
anderen Seite, vor dem Büro des Gouvernörs von Ontario, weht die kanadische Flagge auf
Halbmast, darunter liegt ein einzelner, verwelkter Blumenstrauß in Zellophan. Das
Schneetreiben wird heftiger, ich schlage den Kragen hoch. Aus der Internetausgabe der
Zeitung erfahre ich kurz darauf, daß der Streik frühestens am Montag beginnt. Die Autofahrer
üben den Ernstfall.
Aus der grade noch klaren Luft fallen übergangslos kleine Schneeflocken und legen sich auf
die Windschutzscheiben der Autos. Die Straße ist belegt mit einer großen, unbeweglichen
Autowurst, leicht zu überqueren heute, am ersten Tag des Nahverkehrsstreiks. Auf der
anderen Seite, vor dem Büro des Gouvernörs von Ontario, weht die kanadische Flagge auf
Halbmast, darunter liegt ein einzelner, verwelkter Blumenstrauß in Zellophan. Das
Schneetreiben wird heftiger, ich schlage den Kragen hoch. Aus der Internetausgabe der
Zeitung erfahre ich kurz darauf, daß der Streik frühestens am Montag beginnt. Die Autofahrer
üben den Ernstfall.
 Die Bibliothek ist geformt wie ein Pfau, der Schwanzfedernbusch aus Beton ist sechseckig
und voller Bücher, der lange Hals wohl ein Lüftungskamin oder funktionslos. Im Inneren
des Sechsecks steckt ein kleineres, durch das die Aufzugsschächte laufen, und an jeder
der sechs Seiten gibt es zwei Türen, die in den größeren Sechseckring hinaus führen, wo
die Bücher wohnen. Ich nehme dieselbe falsche Tür wie das letztemal, umrunde ungeduldig
das halbe Sechseck auf der Suche nach dem richtigen Signaturbereich. Wieder steht das
Buch nicht in seiner Abteilung, obwohl der Katalog es hier weiß. Wie das letztemal schon
suche ich die Nachbarregale ab und finde nichts. Schon habe ich mich halb abgewandt, als
mir etwas einfällt. Ich nehme einen Stoß Bücher aus dem Regal, und hinter den anderen,
querstehend, die Seiten aufgeblättert, steht klein und blau das Buch.
Die Bibliothek ist geformt wie ein Pfau, der Schwanzfedernbusch aus Beton ist sechseckig
und voller Bücher, der lange Hals wohl ein Lüftungskamin oder funktionslos. Im Inneren
des Sechsecks steckt ein kleineres, durch das die Aufzugsschächte laufen, und an jeder
der sechs Seiten gibt es zwei Türen, die in den größeren Sechseckring hinaus führen, wo
die Bücher wohnen. Ich nehme dieselbe falsche Tür wie das letztemal, umrunde ungeduldig
das halbe Sechseck auf der Suche nach dem richtigen Signaturbereich. Wieder steht das
Buch nicht in seiner Abteilung, obwohl der Katalog es hier weiß. Wie das letztemal schon
suche ich die Nachbarregale ab und finde nichts. Schon habe ich mich halb abgewandt, als
mir etwas einfällt. Ich nehme einen Stoß Bücher aus dem Regal, und hinter den anderen,
querstehend, die Seiten aufgeblättert, steht klein und blau das Buch.
 Die Schnee ist schwer und angetaut, die Spuren der Menschen und der Tiere sind groß geworden davon
und führen in leere, schon freigetaute Inseln. Queens Park, das Provinzparlament, liegt bestrahlt
in der Nacht, vor ihm auf dem verlassenen Parkplatz eine Gruppe Kinder, Kerzen, Schilder, ein
großer Kranz mit chinesischen Schriftzeichen in der Mitte. Wir stehen in 50 Metern Entfernung,
sind müde, wenn wir jetzt hingehen, müssen wir uns unterhalten, erfahren, wofür die Kinder hier
sind um neun Uhr abends. Zögernd, Schritt für Schritt, gehen wir nach Hause.
Die Schnee ist schwer und angetaut, die Spuren der Menschen und der Tiere sind groß geworden davon
und führen in leere, schon freigetaute Inseln. Queens Park, das Provinzparlament, liegt bestrahlt
in der Nacht, vor ihm auf dem verlassenen Parkplatz eine Gruppe Kinder, Kerzen, Schilder, ein
großer Kranz mit chinesischen Schriftzeichen in der Mitte. Wir stehen in 50 Metern Entfernung,
sind müde, wenn wir jetzt hingehen, müssen wir uns unterhalten, erfahren, wofür die Kinder hier
sind um neun Uhr abends. Zögernd, Schritt für Schritt, gehen wir nach Hause.
 Die Tür des Aufzugs hat schon begonnen sich zu schließen, als ein braunhaariger junger
Mann mit Rastafrisur den Rufknopf drückt. Auf halbem Weg halten die Flügel kurz inne,
öffnen sich wieder. Beinahe schiebt Rastaman seine Begleitung, zwei dicke Männer, in die
Kabine, die Türen schließen jetzt, bitte Zurückbleiben. Mit einem Ruck macht sich der
altersschwache Aufzug an die Schleichfahrt, einer der beiden Dicken bohrt in der Nase,
zieht den Finger heraus - kaum glaublich, daß der dicke Finger eben noch in dieses
Nasenloch paßte - leckt an ihm, verliert das Interesse. Der andere hält den Kopf schräg
und schaut an die Decke, Rastaman lächelt verlegen. Der Bohrer streckt die Zunge heraus,
vorsichtig und langsam, als trete seine Zunge zum erstenmal vor die Lippen und müsse
sich erst versichern, daß die Luft rein ist. Der Aufzug hält, Rastaman schiebt seine beiden
hinaus auf den dritten Stock, ich fahre in den fünften. Der Konferenzraum ist abgeschlossen,
ich setze mich in den Wartebereich der Neurologie, ratlos. Wenig später biegt Dimitri
um eine Ecke, "Journal Club has been cancelled" sagt er, "but there's food, come on."
Er zögert einen Moment, "you're not here to see somebody, are you?" Er grinst über
seinen Witz.
"No" sage ich, und folge ihm zum Lunch.
Die Tür des Aufzugs hat schon begonnen sich zu schließen, als ein braunhaariger junger
Mann mit Rastafrisur den Rufknopf drückt. Auf halbem Weg halten die Flügel kurz inne,
öffnen sich wieder. Beinahe schiebt Rastaman seine Begleitung, zwei dicke Männer, in die
Kabine, die Türen schließen jetzt, bitte Zurückbleiben. Mit einem Ruck macht sich der
altersschwache Aufzug an die Schleichfahrt, einer der beiden Dicken bohrt in der Nase,
zieht den Finger heraus - kaum glaublich, daß der dicke Finger eben noch in dieses
Nasenloch paßte - leckt an ihm, verliert das Interesse. Der andere hält den Kopf schräg
und schaut an die Decke, Rastaman lächelt verlegen. Der Bohrer streckt die Zunge heraus,
vorsichtig und langsam, als trete seine Zunge zum erstenmal vor die Lippen und müsse
sich erst versichern, daß die Luft rein ist. Der Aufzug hält, Rastaman schiebt seine beiden
hinaus auf den dritten Stock, ich fahre in den fünften. Der Konferenzraum ist abgeschlossen,
ich setze mich in den Wartebereich der Neurologie, ratlos. Wenig später biegt Dimitri
um eine Ecke, "Journal Club has been cancelled" sagt er, "but there's food, come on."
Er zögert einen Moment, "you're not here to see somebody, are you?" Er grinst über
seinen Witz.
"No" sage ich, und folge ihm zum Lunch.
 Die Zeichen tanzen über den Bildschirm und formen Muster, gestern erst haben ähnliche
Muster Peter Jackson die Oscars abgejagt vor aller Augen. Traurig saß er da, während der
verrückte Mathematiker dem verrückten Zauberer die Schau stahl.
Meine Muster hier ordnen sich allmählich, jetzt sehe ich: die Koordinaten werden in beiden
Hälften des Stereogrammes gleich geändert, es gibt keine Disparität. Ein Vorzeichenfehler
frißt während ich zusehe die Ergebnisse der letzten Wochen, Monate. Ich denke an die
Freunde in Europa, das Loch im Konto, daran, daß wir im Moment nicht verstehen, was die
Daten besagen, nicht mehr sicher sind, daß unser Ansatz überhaupt taugt. Und hole mir
erst mal ein Getränk.
Die Zeichen tanzen über den Bildschirm und formen Muster, gestern erst haben ähnliche
Muster Peter Jackson die Oscars abgejagt vor aller Augen. Traurig saß er da, während der
verrückte Mathematiker dem verrückten Zauberer die Schau stahl.
Meine Muster hier ordnen sich allmählich, jetzt sehe ich: die Koordinaten werden in beiden
Hälften des Stereogrammes gleich geändert, es gibt keine Disparität. Ein Vorzeichenfehler
frißt während ich zusehe die Ergebnisse der letzten Wochen, Monate. Ich denke an die
Freunde in Europa, das Loch im Konto, daran, daß wir im Moment nicht verstehen, was die
Daten besagen, nicht mehr sicher sind, daß unser Ansatz überhaupt taugt. Und hole mir
erst mal ein Getränk.
 Der Büchersupermarkt hat für Ostern eingedeckt, auf kleinen Tischchen liegen bunte
Decken und Berge bunter Bücher, Einheitsbunt. Am Rande des Tisches steht ein Korb mit
pelzigen gelben Dingern mit großen Augen und einem Aufkleber, auf dem "hit me" steht
oder etwas ähnliches. Ich werfe es zurück in den Korb, aus dem ich es ratlos genommen
hatte. Es macht "Boioioing", das schlimme Pointengeräusch schlechter Comedy. Ich nehme
den Korb, vielleicht dreißig Fluffdinger sind drin, hebe ihn hoch und lasse ihn aus
zehn Zentimeter Höhe auf den Tisch fallen. Dreißigstimmiges "Boing" begleitet meinen
pointierten Abgang.
Der Büchersupermarkt hat für Ostern eingedeckt, auf kleinen Tischchen liegen bunte
Decken und Berge bunter Bücher, Einheitsbunt. Am Rande des Tisches steht ein Korb mit
pelzigen gelben Dingern mit großen Augen und einem Aufkleber, auf dem "hit me" steht
oder etwas ähnliches. Ich werfe es zurück in den Korb, aus dem ich es ratlos genommen
hatte. Es macht "Boioioing", das schlimme Pointengeräusch schlechter Comedy. Ich nehme
den Korb, vielleicht dreißig Fluffdinger sind drin, hebe ihn hoch und lasse ihn aus
zehn Zentimeter Höhe auf den Tisch fallen. Dreißigstimmiges "Boing" begleitet meinen
pointierten Abgang.
 Vom bedeckten Himmel fällt ein leichtes Geniesel. Yonge, die Straße, die nie schläft, wie die
Einheimischen sagen, schläft noch. Geschlossen sind die Läden, nur an einer dunklen Boutique
steht "open, come in", es ist aber gelogen. In einem Internetcafe kann ich dann doch CD-Rohlinge
kaufen. Sie kosten 2 Dollar 50.
Vom bedeckten Himmel fällt ein leichtes Geniesel. Yonge, die Straße, die nie schläft, wie die
Einheimischen sagen, schläft noch. Geschlossen sind die Läden, nur an einer dunklen Boutique
steht "open, come in", es ist aber gelogen. In einem Internetcafe kann ich dann doch CD-Rohlinge
kaufen. Sie kosten 2 Dollar 50.Hofstadter schrieb einmal, um Währungen zu vergleichen reiche nicht der Wechselkurs, man müsse die Berglandschaft der Produktpreise zeichnen, einen Gipfel für Käse haben sie hier in Kanada und einen für Alkohol und ein tiefes Tal für Gaststättenessen dazwischen. Seltsam ist diese Berglandschaft, ein Abendessen zu zweit und ein Kinobesuch danach ist genauso teuer wie zweimal beim Abbiegen das Blinken zu vergessen oder zweimal nicht die Spur zu wechseln, wo es erforderlich ist. Melancholisch bemerke ich, daß ich an anderen Tagen um diese Zeit noch im Bett läge. Seltsam, denke ich, daß zwei schöne Abende zu zweit das Doppelte kosten, alle Fehler auf einmal zu machen aber nicht. Ich höre mich das denken und weiß, ich brauche einen Kaffee.
 Der Weg führt durch den Park, der Tag ist kalt, wie üblich zu dieser Jahreszeit, im warmen Winter
dieses Jahres dennoch eine Ausnahme, und erinnern uns, wie wir schon einmal gingen, vor ein paar Tagen,
als es warm war. Wir schlenderten mehr als wir gingen, und kurz nach dem von Tauben beschissenen Denkmal
blieben wir stehen und sahen uns die Fassade des Parlaments vielleicht an. Kaum standen wir dort einige
Sekunden, merkten die Hörnchen auf und kamen mit zuckenden Schwänzen näher. Hatten wir
Futter? Als ein paar Hörnchen uns umringten und erwartungsfroh guckten, wurden auch die weiter
Entfernten aufmerksam. Die Hörnchentraube wuchs, dann segelte ein Taubenschwarm heran und ließ
sich nieder. Es war kein Halten mehr, von entfernten Bämen hangelten sich die Nager heran, ein weiterer
Taubenschwarm schwamm durch die Stämme und ergänzte das Bild. Fünf Meter in alle Richtungen,
dicht an dicht, saßen die Tiere und suchten das Futter. Wir hatten nicht eine einzige Erdnuß
geworfen.
Der Weg führt durch den Park, der Tag ist kalt, wie üblich zu dieser Jahreszeit, im warmen Winter
dieses Jahres dennoch eine Ausnahme, und erinnern uns, wie wir schon einmal gingen, vor ein paar Tagen,
als es warm war. Wir schlenderten mehr als wir gingen, und kurz nach dem von Tauben beschissenen Denkmal
blieben wir stehen und sahen uns die Fassade des Parlaments vielleicht an. Kaum standen wir dort einige
Sekunden, merkten die Hörnchen auf und kamen mit zuckenden Schwänzen näher. Hatten wir
Futter? Als ein paar Hörnchen uns umringten und erwartungsfroh guckten, wurden auch die weiter
Entfernten aufmerksam. Die Hörnchentraube wuchs, dann segelte ein Taubenschwarm heran und ließ
sich nieder. Es war kein Halten mehr, von entfernten Bämen hangelten sich die Nager heran, ein weiterer
Taubenschwarm schwamm durch die Stämme und ergänzte das Bild. Fünf Meter in alle Richtungen,
dicht an dicht, saßen die Tiere und suchten das Futter. Wir hatten nicht eine einzige Erdnuß
geworfen.Daran erinnerten wir uns nun, an diesem kalten Weihnachtsfeiertag. Diesmal hatten wir Nüsse dabei, wir wollten sehen, wieviele Millionen Tiere sich mit Futter locken ließen. Aber, vielleicht war es die Kälte, weit und breit ließ sich kein Horn sehen. Selbst die Tauben waren desinteressiert und vereinzelt. Und dann fiel es uns auf: der Park war übersät von, fast konnte man sagen zugeschissen mit, Erdnüssen. Hier und da bequemte sich ein Tier vom Baum, las eine Nuß auf und kletterte wieder nach oben, aber im Ganzen herrschte satte Zufriedenheit.
Unsere Nüsse aßen wir selbst.
 Ich gehe durch die dunkle Stadt, mal wieder. So wie ich Kälte für einen Teil des Stadtbildes
halte, weil ich nur in Winterhalbjahren hier war, halte ich allmählichauch Dunkelheit für einen
Teil der Architektur. Das fehlende Fenster im Büro machts.
Ich gehe durch die dunkle Stadt, mal wieder. So wie ich Kälte für einen Teil des Stadtbildes
halte, weil ich nur in Winterhalbjahren hier war, halte ich allmählichauch Dunkelheit für einen
Teil der Architektur. Das fehlende Fenster im Büro machts.Der Spaziergang führt mich an einem Park entlang, der weit von mir entfernt von hohen Hecken und Büschen begrenzt wird. Niemand ist zu sehen, Orion dreht sich langsam durch den orangeglühenden Stadthimmel. Plötzlich schnaufen die Büsche und keuchen, flimmern vor meinen Augen vor Überraschung, ein hundert Meter langes Stück Vegetation macht plötzlich Lärm. Es dauert ein paar Sekunden, bis ich begreife, daß Gleise dahinter liegen. Die Eisenbahn kommt hier nicht oft vor, man rechnet nicht mit ihr.
Wenig später gehe ich unter den Gleisen durch, und bemerke Schmutz auf dem Boden. Wie in einem Horrorfilm, gleich wird der Held in die Luft gerissen und gefressen, wandert mein Blick von den Flecken am Boden nach oben zu den Doppelträgern. Und dort sitzen sie, wie stinkende, milbenverseuchte Bücher auf einem rostigen Metallregal, und schlafen. Eine öffnet ein Auge, als ich unter ihr durchgehe. Wenn die Taube jetzt schisse, auf meinen kalten Frisur, ich könnte ihr noch nicht mal was antun. Sie sitzt zu hoch in ihrem Taubenregal.
 Der Vortrag war brillant, über Lernen in Neuronen. Er war viel zu lang, unruhig rutschte mancher herum, und
kaum hatte die übliche Fragestunde begonnen, war der halbe Saal aufgesprungen und am gelassen antwortenden
Dozenten vorbei nach draussen geströmt. Ich muß eine Stunde Zug fahren, zu einer anderen Universität
und einem anderen Vortrag. Fast blind vor Eile rase ich durch die Gänge, trotzdem sehe ich sie aus dem
Augenwinkel, zwei kleine hözerne Schaukästen, mit Glasdeckeln. Darin sind Spielzeuglflugzeuge, Knöpfe,
Sicherheitsnadeln und Münzen, viele Münzen, alles sauber aufgereiht und arrangiert wie tote Käfer
in Ernst Jüngers Käferzimmer. Drüber steht "Alien objects from air passages". Beglückt gucke
ich, und gucke, leider muß ich weiter, aber freue mich noch bis in die U-Bahn hinein.
Der Vortrag war brillant, über Lernen in Neuronen. Er war viel zu lang, unruhig rutschte mancher herum, und
kaum hatte die übliche Fragestunde begonnen, war der halbe Saal aufgesprungen und am gelassen antwortenden
Dozenten vorbei nach draussen geströmt. Ich muß eine Stunde Zug fahren, zu einer anderen Universität
und einem anderen Vortrag. Fast blind vor Eile rase ich durch die Gänge, trotzdem sehe ich sie aus dem
Augenwinkel, zwei kleine hözerne Schaukästen, mit Glasdeckeln. Darin sind Spielzeuglflugzeuge, Knöpfe,
Sicherheitsnadeln und Münzen, viele Münzen, alles sauber aufgereiht und arrangiert wie tote Käfer
in Ernst Jüngers Käferzimmer. Drüber steht "Alien objects from air passages". Beglückt gucke
ich, und gucke, leider muß ich weiter, aber freue mich noch bis in die U-Bahn hinein.
 Der Chinese sieht mich ratlos an, und weil ich das schon kenne, wiederhole ich auch ohne seine Frage die
Bestellung noch einmal. Ein Budweiser bitte. Nun sah er mich an, als hätte er gehört, was ich sagte,
glaubte es aber nicht. Schließlich ging er. Ich schob es auf die späte Stunde und las weiter in
meinen Papieren. Minuten später fuhr eine Frühlingsrolle auf, dazu eine kostenlose Kanne Tee,
wie üblich in chinesischen Restaurants. Wie üblich um diese Zeit trank ich nicht davon.
Der Chinese sieht mich ratlos an, und weil ich das schon kenne, wiederhole ich auch ohne seine Frage die
Bestellung noch einmal. Ein Budweiser bitte. Nun sah er mich an, als hätte er gehört, was ich sagte,
glaubte es aber nicht. Schließlich ging er. Ich schob es auf die späte Stunde und las weiter in
meinen Papieren. Minuten später fuhr eine Frühlingsrolle auf, dazu eine kostenlose Kanne Tee,
wie üblich in chinesischen Restaurants. Wie üblich um diese Zeit trank ich nicht davon.Augenblicke später kam ein weiterer Kellner und stellte eine weitere Teekanne neben die erste. Ich hab schon eine, meldete ich mich. You ordered Budweiser? fragte der Kellner. Ein wenig aus der Bahn geworfen von der Antwort nicke ich ratlos, und wiederhole, daß ich schon eine Kanne mit Tee habe. Ich spüre, daß mein Verhalten den Kellner genauso verwirrt wie mich das seine, und bin doppelt verwirrt dadurch. You ordered Budweiser? fragt der Kellner nochmals. Nun verstehe ich gar nichts mehr. Ist der Chinese verrückt geworden? Er stellt mir ein zweites Teeschächen neben das erste, unbenutzte. We can't serve Budweiser after two, sagt er. Vollständig konfus starre ich auf die Teekanne, bis es mir dämmert, die Alkohollizenz gilt nur bis 2 Uhr nachts. Weil man mich schon kennt in diesem 24 Stunden Restaurant, kommt man mir entgegen und serviert das verbotene in einer Teekanne. Und darf es nicht sagen. Thank you, sage ich, und bemühe mich, nicht zu lachen. Zögernd verläßt der Kellner den Ort des Verbrechens, nicht sicher, ob ich verstehe, ob ich vielleicht ein Agent der Alkoholbehörde bin. Als er weg ist hebe ich den Deckel der Kanne und sehe staunend den Bierschaum darin.
 Der Kollege starrt in meinen Mülleimer, aufdringlich, nachdrücklich. What are these? fragt er
schließlich und deutet nach unten. Ich sehe nichts und ihn fragend an. Did you drink alcohol in here?
Er fragt es in einem Tonfall, der nichts Gutes ahnen läßt.
Der Kollege starrt in meinen Mülleimer, aufdringlich, nachdrücklich. What are these? fragt er
schließlich und deutet nach unten. Ich sehe nichts und ihn fragend an. Did you drink alcohol in here?
Er fragt es in einem Tonfall, der nichts Gutes ahnen läßt.Alkohol zu trinken ist in Universitätsgebäuden verboten, man braucht eine Sondergenehmigung. Vor Jahren, erzählt mir der Kollege, gab es eine Jubiläumsparty, auf der auch eine Flasche Wein getrunken werden sollte. Bloß wußte leider niemand, in welchem Raum das öffnen von Weinflaschen erlaubt war. Große Sorge. Ob man den Wein trotzdem trank, weiß er leider nicht.
Als der Kollege wieder weg ist, starre ich noch einen Moment auf den Mülleimer. Dann stehe ich seufzend auf und stecke die beiden Holsten-Flaschen zurück in die braune Tarntüte. They might report you, hatte der Kollege gesagt. Dann werfe ich die Tüte doch wieder in die Papierkorb. Ich bin doch nicht bescheuert. Sollen sie mich foltern! Ich rede nicht.
 Meine Sternschnuppenbilder, so sagt man mir, sind nicht aufzufinden. Zuvor haben vier Mitarbeiter des
Ladens je dreimal die aufgereihten Fototaschen durchsucht, jeder und jede fragte mich nach meinem Nach-,
als es unter Schreiber nicht zu finden war, meinem Vornamen. Geduldig beobachtete ich das muntere Treiben,
doch mit Ingrimm. Als ich sie abgab, war mir mulmig: was, wenn sie die Negative verschlampen? Nach zehn
Minuten vorgetäuschter Aktivität gibt man mir eine Visitenkarte. Man melde sich, wenn die
Fotos (sie müssen hier irgendwo sein, hihi) wieder auftauchen. Jaja.
Meine Sternschnuppenbilder, so sagt man mir, sind nicht aufzufinden. Zuvor haben vier Mitarbeiter des
Ladens je dreimal die aufgereihten Fototaschen durchsucht, jeder und jede fragte mich nach meinem Nach-,
als es unter Schreiber nicht zu finden war, meinem Vornamen. Geduldig beobachtete ich das muntere Treiben,
doch mit Ingrimm. Als ich sie abgab, war mir mulmig: was, wenn sie die Negative verschlampen? Nach zehn
Minuten vorgetäuschter Aktivität gibt man mir eine Visitenkarte. Man melde sich, wenn die
Fotos (sie müssen hier irgendwo sein, hihi) wieder auftauchen. Jaja.Draußen, auf der längsten Straße der Welt, kaufe ich aus Ärger: zwei Flaschen Holsten Pils, eine große Pappschachtel mit drei winzigen Tobleronepralinen drin und zwei Bücher beim Altbuchhändler. Die Pralinen schmecken nicht.
 Zwischen der kleinen Stehlampe auf dem Nachttisch und dem Kopfende des Bettes spannen sich, fast nicht
zu sehen im diffusen Licht, dünne Fäden ohne System. Mitten drin hängt reglos eine Spinne,
sie ähnelt der Zitterspinne, lange Beine strecken sich Richtung Kopfkissen, können es aber nicht
erreichen. Es wär ja auch noch schöner.
Zwischen der kleinen Stehlampe auf dem Nachttisch und dem Kopfende des Bettes spannen sich, fast nicht
zu sehen im diffusen Licht, dünne Fäden ohne System. Mitten drin hängt reglos eine Spinne,
sie ähnelt der Zitterspinne, lange Beine strecken sich Richtung Kopfkissen, können es aber nicht
erreichen. Es wär ja auch noch schöner.Kurz erwäge ich, das Tier vors Fenster zu setzen, wo es metertief in den ungekämmten Hintergarten fiele. Aber ich bin zu müd, lege mich ins Bett und lese im Mammutcomic Cerberus von Siemens stattdessen, Verzeihung, ich meine natürlich den Mammutcomic Cerebus von Dave Sim aus Hamilton, Ontario. Als ich das Licht lösche, sitzt die Spinne unter dem Rand des Lampenschirms und lugt. Ich laß sie lugen.
 Als ich durchs Drehkreuz in der U-Bahn-Station gehe, höre ich von unten das vertraute Rumpeln. Als ich
die Treppe hinunterhaste, höre ich von unten den Dur-Dreiklang, der das öffnen der Türen
anzeigt. Als ich den Bahnsteig erreiche, höre ich den zweiten Dreiklang. Ich stehe vor sich
schließenden Bahntüren. Doch noch bevor sie sich ganz geschlossen haben, öffnen sie sich
wieder, der Schaffer sitzt in meinem Wagen, er sah mich, er läßt mich ein. Eine Passagierin
lächelt froh. Ein kleiner Sieg für uns alle, scheint mir das zu sagen.
Als ich durchs Drehkreuz in der U-Bahn-Station gehe, höre ich von unten das vertraute Rumpeln. Als ich
die Treppe hinunterhaste, höre ich von unten den Dur-Dreiklang, der das öffnen der Türen
anzeigt. Als ich den Bahnsteig erreiche, höre ich den zweiten Dreiklang. Ich stehe vor sich
schließenden Bahntüren. Doch noch bevor sie sich ganz geschlossen haben, öffnen sie sich
wieder, der Schaffer sitzt in meinem Wagen, er sah mich, er läßt mich ein. Eine Passagierin
lächelt froh. Ein kleiner Sieg für uns alle, scheint mir das zu sagen.Der Zug rollt an. In die falsche Richtung. Kurz jagen sich die Gedanken in meinem Kopf: die nächste Station, Museum, benutzt fast niemand. Niemand wird glauben, ich habe dorthin fahren wollen. Jeder wird wissen, ich bin im falschen Zug. Soll ich also eine weiter fahren, bis St. George, wo sich zwei Linien kreuzen, mein Versehen zu vertuschen? Ich habe aber keine Zeit für Neurosen und steige bei Museum aus.
Als ich mich auf dem Bahnsteig umdrehe, sehe ich den Schaffer sich aus dem Wagen lehnen, er schließt die Türen, dann schaut er mich an, begreift. Und lacht.
Lachend wird der Schaffner vom langsam anrollenden Zug aus dem Bahnhof getragen.
 Südlich vom Parlament von Ontario, einem scheinviktorianischen historischen Gebäude, befindet
sich ein Bankturm, die Fassade ist ein spiegelndes Zylindersegment und schließt einen
kleinen Vorplatz ein, in dessen Mitte, zehn Meter unter dem Straßenniveau, der Spielplatz eine
Kindertagesstätte liegt. Im gleißend scharfen Herbstlicht tanzt, in etwa zehn Stockwerken
Höhe, eine Plastiktüte in böigen Winden, sinkt ab, steigt wieder auf, wirft sich hin und
her, um schließlich, von einer ausdauernden Bö erfaßt, weit über das oberste Stockwerk
hinauszusteigen und in einem langen, langen Bogen über University Avenue hinabzusegeln, über
dem Verkehr, der nichts ahnt, in Richtung der Krankenhausbaustelle, wo ich sie aus den Augen verliere,
die Plastiktüte.
Südlich vom Parlament von Ontario, einem scheinviktorianischen historischen Gebäude, befindet
sich ein Bankturm, die Fassade ist ein spiegelndes Zylindersegment und schließt einen
kleinen Vorplatz ein, in dessen Mitte, zehn Meter unter dem Straßenniveau, der Spielplatz eine
Kindertagesstätte liegt. Im gleißend scharfen Herbstlicht tanzt, in etwa zehn Stockwerken
Höhe, eine Plastiktüte in böigen Winden, sinkt ab, steigt wieder auf, wirft sich hin und
her, um schließlich, von einer ausdauernden Bö erfaßt, weit über das oberste Stockwerk
hinauszusteigen und in einem langen, langen Bogen über University Avenue hinabzusegeln, über
dem Verkehr, der nichts ahnt, in Richtung der Krankenhausbaustelle, wo ich sie aus den Augen verliere,
die Plastiktüte.
 In der Warteschleife spielt Aufzugsmusik. Spielt dann wohl in kalifornischen Aufzügen Warteschleifenmusik
oder herrscht da aus Stromspargründen Stille? Die Computerstimme spricht Kaugummi und erklärt wie
man die Zimmer anruft, die zwischen 1000 und 1500 US-Dollar kosten. Ich ahne, daß ich hier falsch bin.
Warum wohnen wir noch gleich in diesem Hotel ab Freitag? Weil es so organisiert wurde, darum.
In der Warteschleife spielt Aufzugsmusik. Spielt dann wohl in kalifornischen Aufzügen Warteschleifenmusik
oder herrscht da aus Stromspargründen Stille? Die Computerstimme spricht Kaugummi und erklärt wie
man die Zimmer anruft, die zwischen 1000 und 1500 US-Dollar kosten. Ich ahne, daß ich hier falsch bin.
Warum wohnen wir noch gleich in diesem Hotel ab Freitag? Weil es so organisiert wurde, darum.Statt 109 Dollar kostet das freundliche Youth Hostel nur 20, davon gehen aber freilich noch die Krisenprozente ab, dann sind es noch 15. Da ist sogar ein Frühstück mit dabei, und Blick aufs Gaslichtviertel vor der Tür, was will man denn eigentlich mehr? Meer? Mal sehen.
 Morgen geht es los, geht es nach San Diego, zur bescheuertsten Neurotagung der Welt, zur größten,
längsten, dicksten. Tausende von Wissenschaftlern stellen Dinge vor, die nur sie und ein paar Kollegen
begreifen, alle laufen durcheinander. Und irgendwo wird Sonntag nachmittag auch mein Poster hängen,
und ich steh davor und erklär mir den Mund fusslig.
Morgen geht es los, geht es nach San Diego, zur bescheuertsten Neurotagung der Welt, zur größten,
längsten, dicksten. Tausende von Wissenschaftlern stellen Dinge vor, die nur sie und ein paar Kollegen
begreifen, alle laufen durcheinander. Und irgendwo wird Sonntag nachmittag auch mein Poster hängen,
und ich steh davor und erklär mir den Mund fusslig.
 Am Morgen ging ich die Straße hinab und ignorierte das Eichhorn, das vom Autoreifen ausgequetscht
tot auf ihr lag. Aus den Straßenbahnschienen lief Wasser, Tränen waren das nicht.
Am Morgen ging ich die Straße hinab und ignorierte das Eichhorn, das vom Autoreifen ausgequetscht
tot auf ihr lag. Aus den Straßenbahnschienen lief Wasser, Tränen waren das nicht.Am Abend kam ich dieselbe Straße herauf, das Eichhorn war weg, dafür machte sich ein Waschbär an den Mülltonnen vor dem Haus zu schaffen. Umkreiste sie, auf der Suche nach dem besten Angriffspunkt. Langsam ging ich näher, kurz gemustert vom Tier und offenbar für harmlos gehalten. Erst als ich bis auf drei Meter heran bin, denkt das Monster an Flucht, aber nur halbherzig. So viel guter Müll, wer gibt den schon gern auf. Gewitzt also klettert der Bär am hölzernen Laternenpfahl empor, gut eineinhalb Meter weit, bis ihm dämmert, daß es grade eine Sackgasse zur Flucht wählte. Ratlos hält es inne und hängt. Guckt in meine Richtung und schnauft. Ich mache einen kleinen Schritt näher, das Tier klettert fünf Zentimeter höher, dann kommt es sich offensichtlich blöd vor und stoppt wieder. Wer ist doofer von uns beiden, frage ich mich, Auge in Auge mit der Wildnis, die viel lieber den Müll durchwühlte als meiner romantischen Stadtneurose zu Willen zu sein. Schließlich trete ich zurück, der Bär steigt schnaufend ab und widmet sich den Säcken.
 Es gab keine Gelegenheit, Noam Rosen anzusprechen, wie ich gehofft hatte. Aber es gab lustige Comedy,
von Muslimen und Juden, das war das Konzept Rosens, der mideastoptimist.com
betreibt, eine Webseite mit guten Nachrichten aus dem mittleren Osten.
Es gab keine Gelegenheit, Noam Rosen anzusprechen, wie ich gehofft hatte. Aber es gab lustige Comedy,
von Muslimen und Juden, das war das Konzept Rosens, der mideastoptimist.com
betreibt, eine Webseite mit guten Nachrichten aus dem mittleren Osten.So anstrengend es war, alleine in einem Publikum zu sitzen, daß sich zu großen Teilen kennt, so angenehm war die Atmosphäre. Große Sorgen machten sich die Beteiligten, daß der Abend scheitern könnte, Rosen sagte wohl fünfmal "this is a weird night" zur Eröffnung, wie als Entschuldigung, aber es wurde nicht weird, es wurde lustig und anrührend.
Danach ist mir, wieder ist es eine warme Nacht, nach Eis, ich mache auf dem Weg zur U-Bahn bei Baskin & Robbins halt. Die Vielfalt der Eissorten erschlägt mich. Was können sie empfehlen, frage ich die uniformierte, schlechtbezahlte Angestellte, und sie freut sich, die Augen strahlen, zu leise gibt sie Antwort, deutet schüchtern aufs Eis, ich bin überwältigt. Was für ein Elend muß die Arbeit hier sein. Ich nehme das Eis, sage ich, aber sie hält mir schon einen Probierlöffel voll hin. Es ist gut.
Wir verabschieden uns, ich gehe davon in die Nacht, herbstlich ist mir zumute. Beinahe muß ich weinen.
 Ich gehe, nach zwei Bier leicht angesäuselt durch die Nacht und wundere mich: die Luft ist mild,
der Herbst meint es gut. Schwarz liegt der Hang des Parks unterm Beinahevollmond, am Horizont heben
sich die Banktürme, tausende Lichter leuchten von innen durchs vergoldete Glas. Die Idee,
Glas Gold beizumischen, läßt in dieser Nacht ihre Obszönität in der City,
hier draußen perlt nur das Licht heran. Lichtfinger durchsuchen die Wolken. Gerne würde
ich mich jetzt aufs Gras legen für ein paar Minuten, aber das hat Robin Williams verdorben,
wie so vieles. Bei aller Euphorie und Trunkenheit, bei allem Wohlfühlen: ein haariges
Kind im Manne will ich nicht sein, bewahre.
Ich gehe, nach zwei Bier leicht angesäuselt durch die Nacht und wundere mich: die Luft ist mild,
der Herbst meint es gut. Schwarz liegt der Hang des Parks unterm Beinahevollmond, am Horizont heben
sich die Banktürme, tausende Lichter leuchten von innen durchs vergoldete Glas. Die Idee,
Glas Gold beizumischen, läßt in dieser Nacht ihre Obszönität in der City,
hier draußen perlt nur das Licht heran. Lichtfinger durchsuchen die Wolken. Gerne würde
ich mich jetzt aufs Gras legen für ein paar Minuten, aber das hat Robin Williams verdorben,
wie so vieles. Bei aller Euphorie und Trunkenheit, bei allem Wohlfühlen: ein haariges
Kind im Manne will ich nicht sein, bewahre.In mein dunkles Zimmer aber möchte ich auch noch nicht zurück. Also wandere ich eine laubbesäte, lange, langweilige Straße, Withrow Avenue, hinab, vorbei an Vorgärten mit Kürbisköpfen, Spinnweben in den Büschen und oranger Beleuchtung. Einmal sehe ich ein gewaltiges Tier kauern, die Läufe liegen bebend an der Flanke, der massige Kopf gebeugt, gewaltige Ohren zittern. Es ist dann aber doch nur ein Strauch. Durch die Riverdale Avenue gehe ich zurück. Sie sieht genauso aus. Wohnen hier auch dieselben Menschen wie drüben in Withrow, und schlafen jetzt?
 Im alternativen Buchladen steht ein stammelnder Althippie, das Gehirn erweicht vom Drogenkonsum,
und fachsimpelt mit der Verkäuferin über Neuroprogramming, die da oben und was man tun kann.
Neben der Kasse liegen Flugblätter für die Independent Press Fair, die ist heute und liegt auf
dem Wegda geh ich hin.
Im alternativen Buchladen steht ein stammelnder Althippie, das Gehirn erweicht vom Drogenkonsum,
und fachsimpelt mit der Verkäuferin über Neuroprogramming, die da oben und was man tun kann.
Neben der Kasse liegen Flugblätter für die Independent Press Fair, die ist heute und liegt auf
dem Wegda geh ich hin.An der Kasse sitzt ein fussliger Fünfzigjähriger und guckt griesgrämig. Er drückt mir ein kopiertes Heft in die Hand, drei Bögen, zwölf Seiten. That's the catalogue. Ungläbig schaue ich in den kargen Raum, in dem fünf Stände schwach besucht dümpeln. Dann begreife ich, durch eine Tür geht es in einen Nebenraum, wo weitere vierzig Stände, belagert von künstlerisch empfindenden, die Ware anbieten. Mich in der Gangesmitte haltend eile ich vorbei, sehe aus den Augenwinkeln Poems, Kunstgewerbe, Kitsch, Fanzines. Nichts interessiert mich, plötzlich will ich nur noch weg aus diesem Sumpf, was interessiert mich das Zeug, das ihr zusammenkreativiert, warum soll ich Sachen lesen, die noch nichtmal lektoriert sind? Wer braucht Gedichte?
Als ich das Schlachtfeld bunter Kunst und der Stimmen aus dem Untergrund verlasse, schäme ich mich ein wenig, schließlich hab ich selbst sowas gemacht, und bin noch nichtmal pro Forma stehengeblieben. Aber jetzt noch freundliche, aufmerksame Mitmenschen, die mir erklären, warum sie ihre Zeit mit Lürik vertun? Die mir erläutern, warum große Verlage böse und kleine unsere Zukunft sind?
Am Abend sehe ich Apocalypse Now Redux, das rückt mir den Kopf wieder zurecht.
 Früher Morgen vor der Abfahrt zur Konferenz nach London, im Dämmerlicht kam ich aus
High Park Station, eine New York Times unter dem Arm und für die Tageszeit erstaunlich munter.
Ein kurzer Blick in die Runde - noch ist niemand hier. Während ich die Zeitung auf einen Poller
lege und aufschlage, blicke ich mich noch einmal um - da ist doch jemand.
Früher Morgen vor der Abfahrt zur Konferenz nach London, im Dämmerlicht kam ich aus
High Park Station, eine New York Times unter dem Arm und für die Tageszeit erstaunlich munter.
Ein kurzer Blick in die Runde - noch ist niemand hier. Während ich die Zeitung auf einen Poller
lege und aufschlage, blicke ich mich noch einmal um - da ist doch jemand.Schnell, aber nicht eilig überquert ein kleiner Waschbär die Straße, guckt kurz in meine Richtung, beschleunigt, als er sieht, daß ich auf ihn zugehe und verschwindet zwischen zwei Häusern. Während ich die Kamera einsatzbereit mache - nur das vollkommen verarbeitete und dokumentierte Erlebnis zählt in einer Medienwelt, selbst privat - folge ich dem Tier durch den Hinterhof, um ein Auto herum, in einen engen Spalt voller Gerümpel. Dort fühlt es sich sicher, dreht sich um, und schaut sich an, wer ihm da folgt. Und meine Kamera löst aus. Der erste Waschbär der Saison. Wachbärbild gemalt von Rachel. Danke.
 Beschwingt hüpfe ich durch den Nieselregen, die Feuerleiter hinauf und zupfe die Abholkarte aus
dem Schiebefenster. Zurück an der Leiter sehe ich den Boden fünfzehn Meter tiefer durch die
glitschigen Metallstreben und mir wird flau und höhenängstlich, aber nicht lange. Der Waschbär
ersteigt dies Nacht für Nacht, sage ich mir, und klettere hinunter.
Beschwingt hüpfe ich durch den Nieselregen, die Feuerleiter hinauf und zupfe die Abholkarte aus
dem Schiebefenster. Zurück an der Leiter sehe ich den Boden fünfzehn Meter tiefer durch die
glitschigen Metallstreben und mir wird flau und höhenängstlich, aber nicht lange. Der Waschbär
ersteigt dies Nacht für Nacht, sage ich mir, und klettere hinunter.Beschwingt gehe ich durch Chinatown, an dem Stand mit den zappelnden Krebsen vorbei, vorbei an Stinkfrucht und Fremdgemüse, denn im Dragon Centre wartet ein Päckchen auf mich. Ein Päckchen! Auf mich!
Mit zitternden Fingern nehme ich es entgegen, am neugebauten, blitzenden Schalter im chinesischen Buchladen, reiße es auf und blättere verblüfft im Katalog der Firma Cayman Chemicals. Cyclooxygenase so viel mein Herz begehrt! Warum ich?
Ich esse eine Hot and Sour Soup beim Chinesen gegenüber und schleiche, deutlich weniger beschwingt, zurück. Es regnet noch immer.
 Nachts ist Toronto am schönsten, dann ragen die Banktürme der Innenstadt wie ein Lichtmosaik
ins Pastellschwarz, milder Wind durchpustet die friedliche Ruhe, Lichtfinger locken
Rastlose in die Nachtclubs und Alltagsgeräusche tun großspurig.
Nachts ist Toronto am schönsten, dann ragen die Banktürme der Innenstadt wie ein Lichtmosaik
ins Pastellschwarz, milder Wind durchpustet die friedliche Ruhe, Lichtfinger locken
Rastlose in die Nachtclubs und Alltagsgeräusche tun großspurig.Neben der Straßenbahnhaltestelle stehen 11 verschlossene Glasflaschen mit Wasser, niemand ist zu sehen, dem sie gehören, sie stehen. Ich schaue hinüber zum Parlament von Ontario, viktorianisch und bestrahlt thront es da, und dann wieder in meine Zeitung.
Deutschland wird wieder eine Militärmacht, schreibt der Kolumnist da, und das Paradoxe daran sei, daß man das begrüße und dem einstigen Aggressor die liberale Demokratie glaube. Der Kommentator freut sich darüber, und mit einem Mal, hier aus der amerikanischen Perspektive, bin ichs - vielleicht das erste Mal - tatsächlich mit dem Geschehenden einverstanden. Die Verwirrung ist schnell überstanden, und als ich in die Straßenbahn steige bleibt nur ein diffus gutes Gefühl, typisch für Herbstnächte. Und 11 Flaschen Wasser, noch verkorkt, bleiben auch.
 Ich sitze in der Badewanne und warte darauf, daß das kärgliche Rinnsal aus dem Duschkopf wenigstens
ein bißchen wärmer wird, denn eiskalt zu duschen ist auch meines Körpers höchstes Glück
nicht. Ich warte, hockend, und warte, aber es ändert sich nichts. Probehalber schließe ich den Hahn,
was bei Computern funktioniert hilft vielleicht auch bei Wasserleitungen, und kurz bevor ich die Dusche reboote,
fällt mir auf, daß das Fließgeräusch in der Leitung so laut ist wie zuvor. Jemand anders
duscht im ersten Stock! Duscht mir das warme Wasser weg! "Asshole", denke ich, drehe die Leitung wieder an
und dusche mich fröstelnd ab.
Ich sitze in der Badewanne und warte darauf, daß das kärgliche Rinnsal aus dem Duschkopf wenigstens
ein bißchen wärmer wird, denn eiskalt zu duschen ist auch meines Körpers höchstes Glück
nicht. Ich warte, hockend, und warte, aber es ändert sich nichts. Probehalber schließe ich den Hahn,
was bei Computern funktioniert hilft vielleicht auch bei Wasserleitungen, und kurz bevor ich die Dusche reboote,
fällt mir auf, daß das Fließgeräusch in der Leitung so laut ist wie zuvor. Jemand anders
duscht im ersten Stock! Duscht mir das warme Wasser weg! "Asshole", denke ich, drehe die Leitung wieder an
und dusche mich fröstelnd ab.Als ich aus der Dusche steige, sehe ich, daß der Wasserhahn am Waschbecken lauwarm sprudelt, ich stelle ihn ab,alle Geräusche ersterben, stattdessen muß ich lachen.
Als wir wiederkommen, sind aus den sechs Wartenden 12 geworden, die Schlange nimmt Form an, der Bus läuft immer noch, der Konzertsaal ist immer noch geschlossen. Wir stellen uns an, und nach und nach kommen weitere Verwirrte hinzu. Ein Neuankömmling fragt, ob das Konzert, wie auf seiner Karte stehe, um acht beginne, oder wie man ihm beim Kartenverkauf gesagt habe, um fünf. Wir wissen es nicht, ahnen aber Böses. Der Bus stinkt.
Eine Dreiviertelstunde später hat man die sich langsam verlängernde Schlange einmal um den noch immer laufenden Bus herumgeführt und wonaders neu aufgebaut, vermutlich um uns bei Laune zu halten. Es sind vielleicht 60 Leute, die warten, eine Schlange ist eigentlich unnötig. Ein Zuhörer kommt grantig wiederwann sie uns reinlassen, weiß er nicht, aber der Bus müsse laufen, weil er der Generator sei. Er finde das "fucking ridiculous", zuckt die Achseln und stellt sich wieder an.
Nochmal eine halbe Stunde später läßt man uns ein, und um 25 nach sieben beginnt das Konzert. Aus zwei Kanonen werden tausende kleiner Zettel auf uns abgeschossen, blau und rot, während die Anmoderation noch nachhallt"this is a song about the eleventh". Pause. "president of the United States, James K. Polk". Das Lied ist sehr lustig, die Zettel werden noch das ganze Konzert über vereinzelt von der Decke segeln.
Zu New York sagen sie, abgesehen vom eleventh-Anmoderationswitz fast nichts, aber sie spielen das Cover New York City, und diese Mischung aus ironischer Hommage und Liebeslied rührt mich sehr.
Nach der ersten Zugabe gehen die Saallichter an, mürrisch, aber zufrieden denkt das Publikum ans Aufbrechen, da bellt Flansburgh durchs Mikroman könne noch bleiben und auf die Disco warten, die anschließend in diesen Räumen stattfinde. Oder man könne in dreißig Sekunden noch mehr von They Might Be Giants hören. Und jetzt solle man bitte das Saallicht wieder löschen, danke. Euphorie macht sich breit, die Musiker eilen auf die Bühne und beginnen "Istanbul, Not Constantinople". Das Saallicht geht an, und nach giftigem Kommentar von Flansburgh auch brav wieder aus. "Istanbul, Not Constantinople ist ein Renner".
Beim Hinausgehen halte ich an, um mir von John Flansburgh das Buch signieren zu lassen, in das die Bank meine Kontoauszüge druckt.
 Als ich die Trailer sehe, die dem Film The Deep End
vorausgehen, wird mir klar, daß das neue Jahrzehnt oder Jahrtausend tatsächlich da ist. Das
visuelle Design hat sich geändert, die Schnitte sind schneller, die Computereffekte weniger
vordergründig und deshalb bestimmender fürs Bild. Besonders auffällig ist der Wechsel
bei Waking Life, dem neuen Film von Richard Linklater, der schon Before Sunrise auf dem Gewissen hat.
Aber auch From Hell mit Johnny Depp sieht, zumindest der Trailer, seltsam neu aus.
Als ich die Trailer sehe, die dem Film The Deep End
vorausgehen, wird mir klar, daß das neue Jahrzehnt oder Jahrtausend tatsächlich da ist. Das
visuelle Design hat sich geändert, die Schnitte sind schneller, die Computereffekte weniger
vordergründig und deshalb bestimmender fürs Bild. Besonders auffällig ist der Wechsel
bei Waking Life, dem neuen Film von Richard Linklater, der schon Before Sunrise auf dem Gewissen hat.
Aber auch From Hell mit Johnny Depp sieht, zumindest der Trailer, seltsam neu aus.Zweimal schon mußte ich Duschgel und Shampoo kaufen, die erste Ausstattung nämlich vergaß ich im Hotel in London, und beide Male fiel mir auf, daß nahezu alle Marken Design und Form der Flaschen und Flacons verändert hatten. Alle zehn Jahre ändert die Welt, weil wir zehn Finger haben, ihr Aussehen.
Im Sammelband "Best of the Annals of Improbable Research" steht ein Paper, das über die rätselhaften Wachstumseigenschaften von Gras berichtet. Alle 7-10 Tage nimmt die Länge der Halme abrupt ab, ohne eine bestimmte Mindestlänge zu unterschreiten. Ist also Design kulturelles Rasenmähen?
 Als ich Ende Dezember 2000 den Antrag für ein Appartment abgebe, sagt man mir, ich solle im Juli
nachfragen, im September könnte was frei sein. Im Juli heißt es, vielleicht im Oktober. Im August
schreibe ich eine E-Mail. Vielleicht im November, schreibt es zurück. Im September rufe ich an.
November werde schwierig. Dezember vielleicht? Im Oktober lande ich wieder in Toronto und gehe persönlich
vorbei. Dezember, sagt die freundliche Dame, sei zwar noch möglich, aber unwahrscheinlich. Eher schon
werde es Januar. Zerknirscht wanke ich hinaus, wo sollen wir denn wohnen! Himmel! Einen Tag später gehe
ich zurück. Mehrfach wurde mir geraten, eine Szene zu machen, unangenehm zu werden. Ich mag dergleichen
nicht, kann es auch nicht, zu viel Mitgefühl mit dem Gegenüber steht im Weg, wenn ich nicht wirklich
sauer bin. Diesmal gelingt es so halbwegs, ich zetere ein wenig, über das Wohnproblem, wo sollen wir hin?
Wie soll ich für einen Monat was finden, und versuche hilflos und verzweifelt zu wirken. Die
Sachbearbeiterin ist freundlich, sagt ein paar Floskeln - wir verständigen Sie, wenn wir was haben - und
schiebt mich zur Tür raus.
Als ich Ende Dezember 2000 den Antrag für ein Appartment abgebe, sagt man mir, ich solle im Juli
nachfragen, im September könnte was frei sein. Im Juli heißt es, vielleicht im Oktober. Im August
schreibe ich eine E-Mail. Vielleicht im November, schreibt es zurück. Im September rufe ich an.
November werde schwierig. Dezember vielleicht? Im Oktober lande ich wieder in Toronto und gehe persönlich
vorbei. Dezember, sagt die freundliche Dame, sei zwar noch möglich, aber unwahrscheinlich. Eher schon
werde es Januar. Zerknirscht wanke ich hinaus, wo sollen wir denn wohnen! Himmel! Einen Tag später gehe
ich zurück. Mehrfach wurde mir geraten, eine Szene zu machen, unangenehm zu werden. Ich mag dergleichen
nicht, kann es auch nicht, zu viel Mitgefühl mit dem Gegenüber steht im Weg, wenn ich nicht wirklich
sauer bin. Diesmal gelingt es so halbwegs, ich zetere ein wenig, über das Wohnproblem, wo sollen wir hin?
Wie soll ich für einen Monat was finden, und versuche hilflos und verzweifelt zu wirken. Die
Sachbearbeiterin ist freundlich, sagt ein paar Floskeln - wir verständigen Sie, wenn wir was haben - und
schiebt mich zur Tür raus.Mir ist klar, daß sie das ständig hört, daß es nicht helfen wird, daß ich viel Geld für eine Übergangswohnung einplanen muß. Und alles nur, weil ich den Satz "Ich möchte den Manager sprechen" nicht gelernt habe.
Drei Stunden später bekomme ich einen Anruf. Wir haben eine Wohnung. Im Dezember.
 Windermere Manor. In solchen Dingern verbringt der Kanadier seine Konferenzen, da heiratet er, da ist er ganz er selbst. Drinnen
gibt es leckeres Essen und Vorträge, vor dem Fenster regnet es bei milden Temperaturen, und die
Hoteldoppelzimmer sind größer als das
Apartment sein
wird, das wir bekommen sobald der Kanadier will.
Windermere Manor. In solchen Dingern verbringt der Kanadier seine Konferenzen, da heiratet er, da ist er ganz er selbst. Drinnen
gibt es leckeres Essen und Vorträge, vor dem Fenster regnet es bei milden Temperaturen, und die
Hoteldoppelzimmer sind größer als das
Apartment sein
wird, das wir bekommen sobald der Kanadier will.Auf der Fahrt dahin glaube ich mich daran zu erinnern, daß Hemingway was mit Windermere zu tun hatte, irgendwas, und so seltsam es ister hat. In London, Ontario gibt es außer Windermere Manor St. Pauls Cathedral, zwei River Thames, Oxford und Piccadilly Street und eine Statue, auf der ein Waschbär beim Mülltonneplündernd zu sehen ist, mit der Unterschrift "London's Night Life",
 Darf ich grade mal auf The Onion hinweisen? Ich darf? Fein.
Lesen Sie also diese Zeitschrift, sie ist lustig!
Darf ich grade mal auf The Onion hinweisen? Ich darf? Fein.
Lesen Sie also diese Zeitschrift, sie ist lustig!
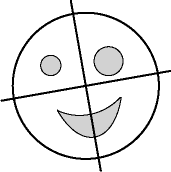 Grinsgesichter, kleine, miese, die Geschichte, die ist diese: Stereogramme machen Menschen schielen.
Schielen und nach unten gucken macht Augen
drehen. Gedrehte Stereogramme können also aussehn, als gucke man nach unten. Sterogramme sehen ist leichter,
wenn das Gehirn weiß, wohin die Augen gucken und die Information auch nutzt. Wir zeigten abernutzt es
nicht. Stereogramme verraten aber auch selbst, wohin die Augen gucken. Vielleicht nutzt das Gehirn diese
visuelle Information. Um das rauszufinden, vergleichen wir Stereogramme, die eine bestimmte Blickrichtung
kodieren mit welchen, die widersprüchlich sind. Wenn die Information genutzt wird, macht der Widerspruch
was aus. Wenn nicht, nicht. Dazu gehören Folien auf denen dieses Grinsegesicht zu sehen ist. Der Vortrag
dauert zehn Minuten. Zehn Minuten Fragen hinterdrein. Das ist ein Teil des Tuns, das Wissenschaft heißt.
Grinsgesichter, kleine, miese, die Geschichte, die ist diese: Stereogramme machen Menschen schielen.
Schielen und nach unten gucken macht Augen
drehen. Gedrehte Stereogramme können also aussehn, als gucke man nach unten. Sterogramme sehen ist leichter,
wenn das Gehirn weiß, wohin die Augen gucken und die Information auch nutzt. Wir zeigten abernutzt es
nicht. Stereogramme verraten aber auch selbst, wohin die Augen gucken. Vielleicht nutzt das Gehirn diese
visuelle Information. Um das rauszufinden, vergleichen wir Stereogramme, die eine bestimmte Blickrichtung
kodieren mit welchen, die widersprüchlich sind. Wenn die Information genutzt wird, macht der Widerspruch
was aus. Wenn nicht, nicht. Dazu gehören Folien auf denen dieses Grinsegesicht zu sehen ist. Der Vortrag
dauert zehn Minuten. Zehn Minuten Fragen hinterdrein. Das ist ein Teil des Tuns, das Wissenschaft heißt.
 Geschichte aus dem Busch:
Geschichte aus dem Busch:Eines Herbstes paddelten zwei wildnishörige Wissenschaftler durch die Wildnis. Sie hatten für die Nacht ein Lager errichtet und klärten nun noch den weiteren Flußverlauf, um am nächsten Tag zu wissen, wo es lang gehen sollte. Um das Lager besser wiederzufinden, hängten sie ein Handtuch in hellen Farben an einen Busch am Ufer, gut sichtbar im scharfen kanadischen Licht.
Nun war es aber Herbst, die herabsinkende Sonne rief ihre Freunde, die Wolken herbei und der Mond ließ auf sich warten, kurz, ehe sichs die Paddler versahen, war es allerfinsterste Nacht, die berühmte Hand vor Augen war ein Gerücht aus helleren Zeiten und guter Rat teuer. Man entschied sich, im Zickzack hin und herzupaddeln, jeweils zu wenden, wenn man aufs Ufer stieß, in der Hoffnung, so zurück zum Lager zu gelangen. Und während einer dieser Zickzackbewegungen nun peitschte ein Knall durch die Schwärze wie von einem Gewehr, die Paddler sprangen beinahe über Bord vor Schreck. Es war ein Biber gewesen, tauchend, der den breiten Schwanz aufs Wasser knallen ließ.
Später verzehrten die Paddler Muscheln, die so schmecken, wie der Sumpf riecht, Wurzeln mit Spülmittelgeschmack und erschossen einen Elch. Am lautesten aber knallte heimtückisch der Biber.
(Bild gestohlen bei Krittercards).
 Als ich das Licht auf dem Gang lösche, wird es was der Angelsachse pitch black nennt, man sieht die
Hand nicht vor Augen, tapsig tapse ich in mein neues, fremdes Zimmer und mache mich in der Lichtlosigkeit
kleiderlos. Dann tapse ich weiter zum Futon, taste nach dem Wecker (nichts fällt, nichts stürzt, wieso?),
und nutze die Ziffernblattbeleuchtung (sagt man bei Digitalweckern Ziffernblattbeleuchtung? Oder muß man
Anzeigenbeleuchtung sagen?) zur Orientierung, um das Schlafgewand zu finden. Dann falte ich das Futon flach,
allmählich kann ich schon das Fenster vom Rest des Zimmers unterscheiden. Die Lampe brauche ich nicht
auszumachen, kann ich auch gar nicht, weil sie kaputt ist. Ich kann also sofort einschlummern. Ganz
dunkel wird es jetzt in meinem Kopf.
Als ich das Licht auf dem Gang lösche, wird es was der Angelsachse pitch black nennt, man sieht die
Hand nicht vor Augen, tapsig tapse ich in mein neues, fremdes Zimmer und mache mich in der Lichtlosigkeit
kleiderlos. Dann tapse ich weiter zum Futon, taste nach dem Wecker (nichts fällt, nichts stürzt, wieso?),
und nutze die Ziffernblattbeleuchtung (sagt man bei Digitalweckern Ziffernblattbeleuchtung? Oder muß man
Anzeigenbeleuchtung sagen?) zur Orientierung, um das Schlafgewand zu finden. Dann falte ich das Futon flach,
allmählich kann ich schon das Fenster vom Rest des Zimmers unterscheiden. Die Lampe brauche ich nicht
auszumachen, kann ich auch gar nicht, weil sie kaputt ist. Ich kann also sofort einschlummern. Ganz
dunkel wird es jetzt in meinem Kopf.Der erste Anblick am nächsten Morgen ist im Halbdunkel vor dem Fenster ein federnder Ast und ein springender Schatten aus Pelz. Besser das Eichhorn auf dem Dach als andersrum.
 Als ich aus dem Haus trat und durch den
Park zur Autobahn, dem Don Valley Parkway,
hinabtappte, beobachtete mich ein Eichhorn und machte Eichhorngeräusche. Die Brücke überspannte
acht Spuren und träge fließendes Lehmiges, und am anderen Ende wartet ein Schaubauernhof mit
Wasserlinsen und dummem Freßgeflügel. Acht Spuren! Eichhorngequietsch! Was will man mehr vor der
eigenen Haustür?
Vor mir wird von der asiatischen Frau eine große Schüssel Pho aufgebaut. Drin schwimmt ein
Kilogramm Nudeln, wie mir scheint, und ein Phoduft schmeichelt der Nase. Bang frage ich mich, ob das
Hauptgericht, das sicherlich in Sekunden an meinen Tisch geliefert werden wird, die Suppe an Volumen und
Nahrhaftigkeit noch übertreffen mag. Das mit am Tisch sitzende junge Paar unterhält sich, sie hat
eine angenehme Stimme, aber den verbreiteten, nöligen Tonfall junger Kanadierinnen. Der junge Mann dagegen
klingt wie junge Männer nun mal so klingen. Das Hauptgericht kommt und ist wie erwartet zu reichhaltig,
die Suppennudeln werden wohl in der Suppenschüssel zurückgehen müssen. Kurz denke ich an
Tampopo, und sehe weinende Asiaten über meine
Schüssel gebeugt die Hände ringen, dann weichen die Flausen und ich lese wieder im Private Eye
nach, wie die britische Öffentlichkeit über Lockerbie getäscht wurde. Da! Die Asiatin rämt
die Nudelschüssel ab, stößt dabei (versehentlich?) ans Wasserglas, das Glas fällt,
das Privatauge färbt sich dunkelgrau auf vielen Seiten. Gleichmütig wie ein Zenmeister blicke ich
auf, "it doesn't matter, it's only water", sage ich zur verlegenen Abträgerin, und sehe das Paar an meinem
Tisch dabei an. Es sind zwei Männer.
Als ich aus dem Haus trat und durch den
Park zur Autobahn, dem Don Valley Parkway,
hinabtappte, beobachtete mich ein Eichhorn und machte Eichhorngeräusche. Die Brücke überspannte
acht Spuren und träge fließendes Lehmiges, und am anderen Ende wartet ein Schaubauernhof mit
Wasserlinsen und dummem Freßgeflügel. Acht Spuren! Eichhorngequietsch! Was will man mehr vor der
eigenen Haustür?
Vor mir wird von der asiatischen Frau eine große Schüssel Pho aufgebaut. Drin schwimmt ein
Kilogramm Nudeln, wie mir scheint, und ein Phoduft schmeichelt der Nase. Bang frage ich mich, ob das
Hauptgericht, das sicherlich in Sekunden an meinen Tisch geliefert werden wird, die Suppe an Volumen und
Nahrhaftigkeit noch übertreffen mag. Das mit am Tisch sitzende junge Paar unterhält sich, sie hat
eine angenehme Stimme, aber den verbreiteten, nöligen Tonfall junger Kanadierinnen. Der junge Mann dagegen
klingt wie junge Männer nun mal so klingen. Das Hauptgericht kommt und ist wie erwartet zu reichhaltig,
die Suppennudeln werden wohl in der Suppenschüssel zurückgehen müssen. Kurz denke ich an
Tampopo, und sehe weinende Asiaten über meine
Schüssel gebeugt die Hände ringen, dann weichen die Flausen und ich lese wieder im Private Eye
nach, wie die britische Öffentlichkeit über Lockerbie getäscht wurde. Da! Die Asiatin rämt
die Nudelschüssel ab, stößt dabei (versehentlich?) ans Wasserglas, das Glas fällt,
das Privatauge färbt sich dunkelgrau auf vielen Seiten. Gleichmütig wie ein Zenmeister blicke ich
auf, "it doesn't matter, it's only water", sage ich zur verlegenen Abträgerin, und sehe das Paar an meinem
Tisch dabei an. Es sind zwei Männer.
 Musíme si pomáhat, Ein sehr schöner, lustiger,
anrührender und erschreckender Film über die Tschechoslowakei
unter den Nazis. In einem Alptraum aus Kollaboration, Verrat und ständiger Bedrohung lebt ein
liebenswertes, kinderloses Ehepaar. Von der Handlung sollte man möglichst wenig verraten. Verraten kann man
aber, daß der Film in tschechisch, deutsch und (ein Lied) yiddisch gefilmt wurde, und neben all seinen
anderen Qualitäten ein flammender Appell gegen die Synchronisation sein könnte, würde nur jemand
zuhören. Hallo? Liest das hier noch jemand?
Heute, nach einem Bettsuchausflug auf St. Clair West, greift die Kälte mir unters Hemd, das Ferkel.
Rasch stopfe ich mich dicht, da rieselt auch schon ein kleines Ding vor meiner Nase vorbeider erste Schnee
des Jahres? Ein verwehter Regentropf? Schnell nach drinnen, original Bretzeln kaufen.
Musíme si pomáhat, Ein sehr schöner, lustiger,
anrührender und erschreckender Film über die Tschechoslowakei
unter den Nazis. In einem Alptraum aus Kollaboration, Verrat und ständiger Bedrohung lebt ein
liebenswertes, kinderloses Ehepaar. Von der Handlung sollte man möglichst wenig verraten. Verraten kann man
aber, daß der Film in tschechisch, deutsch und (ein Lied) yiddisch gefilmt wurde, und neben all seinen
anderen Qualitäten ein flammender Appell gegen die Synchronisation sein könnte, würde nur jemand
zuhören. Hallo? Liest das hier noch jemand?
Heute, nach einem Bettsuchausflug auf St. Clair West, greift die Kälte mir unters Hemd, das Ferkel.
Rasch stopfe ich mich dicht, da rieselt auch schon ein kleines Ding vor meiner Nase vorbeider erste Schnee
des Jahres? Ein verwehter Regentropf? Schnell nach drinnen, original Bretzeln kaufen.
 Nach wenigen Tagen Suche fand ich eine Vorübergehbleibe, im schnieken Viertel von
Toronto, wo sich Juppie und Waschbär gute Nacht sagen. Die ersten Juppies sichtete ich bereits beim Einzug,
es kann nicht mehr lange dauern, bis auch die "maskierten Räuber", der Alptraum jedes Hausbesitzers, einen
Fehler machen und sich mir stellen. Fotos des Hauses (schick, womöglich sogar, beware!, gemauert!),
des Zimmers (düster, aber mit Parkett, knatsch, knatsch) und der Aussicht vom Haus aus reiche ich nach.
Sobald ich sie knipste. Vorerst gibt es nur eine
Fotoseite des Streetcars, das mich zur Arbeit
bringen wird.
Nach wenigen Tagen Suche fand ich eine Vorübergehbleibe, im schnieken Viertel von
Toronto, wo sich Juppie und Waschbär gute Nacht sagen. Die ersten Juppies sichtete ich bereits beim Einzug,
es kann nicht mehr lange dauern, bis auch die "maskierten Räuber", der Alptraum jedes Hausbesitzers, einen
Fehler machen und sich mir stellen. Fotos des Hauses (schick, womöglich sogar, beware!, gemauert!),
des Zimmers (düster, aber mit Parkett, knatsch, knatsch) und der Aussicht vom Haus aus reiche ich nach.
Sobald ich sie knipste. Vorerst gibt es nur eine
Fotoseite des Streetcars, das mich zur Arbeit
bringen wird.
 Vor zwo Tagen war ich in der neusten
Stephen-King-Buchbebilderung, und es war, nicht zuletzt
Anthony Hopkins wegen, gar nicht schlecht. Neu auch, daß die Monster keine Monster mehr, sondern
ihre wirkliche Vorlage, die FBI-Agenten der McCarthy-Zeit sind. Daß sie agieren wie die grauen Männer
in Momo, wer will es dem "Master of Horror" verdenken. Ich?
Drei Tage danach aber, im Gemeinschaftsraum eines der Colleges (Wohn- und Identitätsbüchsen, in die die
Studenten an der U of T sortiert werden) gibt es als Free Friday Film
Sullivans Travels von Preston Sturges
zu sehen. Slapstick heiratet Sozialdrama, das ganze beinahe postmodern arrangiert (Magisterstudenten vor! Bzw
gibts die Arbeit doch sicher schon) und mit brillantem Skript. Am Ende hat der Regisseur im Film gelernt,
daß die Geknechteten der Erde keine Dramen brauchen, sondern Komödien. Und der Zuschauer fragt sich, was er
grade sahDrama, Komödie, oder ein Drittes. Solche Filme werden heute ja gar nicht mehr gebaut. Und nur, damit
es auch erwähnt istdieser Film ist die Quelle für den Coen-Filmtitel "O Brother Where
Art Thou".
Ich bin ein Bündel NervThey Might Be Giants, meine
Hausgötter des lustigen Pop, haben nicht nur eine neue CD gemacht, sie kommen auch nach Toronto, am
20. Oktober. Kreiiiiisch! Fansein ist auch mal schön.
Vor zwo Tagen war ich in der neusten
Stephen-King-Buchbebilderung, und es war, nicht zuletzt
Anthony Hopkins wegen, gar nicht schlecht. Neu auch, daß die Monster keine Monster mehr, sondern
ihre wirkliche Vorlage, die FBI-Agenten der McCarthy-Zeit sind. Daß sie agieren wie die grauen Männer
in Momo, wer will es dem "Master of Horror" verdenken. Ich?
Drei Tage danach aber, im Gemeinschaftsraum eines der Colleges (Wohn- und Identitätsbüchsen, in die die
Studenten an der U of T sortiert werden) gibt es als Free Friday Film
Sullivans Travels von Preston Sturges
zu sehen. Slapstick heiratet Sozialdrama, das ganze beinahe postmodern arrangiert (Magisterstudenten vor! Bzw
gibts die Arbeit doch sicher schon) und mit brillantem Skript. Am Ende hat der Regisseur im Film gelernt,
daß die Geknechteten der Erde keine Dramen brauchen, sondern Komödien. Und der Zuschauer fragt sich, was er
grade sahDrama, Komödie, oder ein Drittes. Solche Filme werden heute ja gar nicht mehr gebaut. Und nur, damit
es auch erwähnt istdieser Film ist die Quelle für den Coen-Filmtitel "O Brother Where
Art Thou".
Ich bin ein Bündel NervThey Might Be Giants, meine
Hausgötter des lustigen Pop, haben nicht nur eine neue CD gemacht, sie kommen auch nach Toronto, am
20. Oktober. Kreiiiiisch! Fansein ist auch mal schön.
 Im Kaufrausch bei she-said-boom, College Street
Adbusters über Design,
Z-Magazine über Genua,
Frank über Krieg,
Sceptical Inquirer über Religion und Wissenschaft.
In Adbusters lese ich inmitten von schick desgintem Antidesign eine bemerkenswerte Geschichte.
Nach dem zweiten Weltkrieg, so die drollige Behauptung, hat ein Desginer den Auftrag für eine
Plakatserie für die Faraphirma Pfäfferli + Huber angenommen. Die Firma war in Menschenversuche
in Konzentrationslagern verstrickt, der Designer konterte, indem er vier Plakate entwarf, jedes für sich
harmlos, aber zusammen ergeben siedas Wort NAZI. Links zu sehen
sei das A. Die Kampagne ruinierte
dann die Firma, sagen manche. Andere denken anders.
Im Kaufrausch bei she-said-boom, College Street
Adbusters über Design,
Z-Magazine über Genua,
Frank über Krieg,
Sceptical Inquirer über Religion und Wissenschaft.
In Adbusters lese ich inmitten von schick desgintem Antidesign eine bemerkenswerte Geschichte.
Nach dem zweiten Weltkrieg, so die drollige Behauptung, hat ein Desginer den Auftrag für eine
Plakatserie für die Faraphirma Pfäfferli + Huber angenommen. Die Firma war in Menschenversuche
in Konzentrationslagern verstrickt, der Designer konterte, indem er vier Plakate entwarf, jedes für sich
harmlos, aber zusammen ergeben siedas Wort NAZI. Links zu sehen
sei das A. Die Kampagne ruinierte
dann die Firma, sagen manche. Andere denken anders.